
Der Anbau von Ackerbohnen
Ackerbohnen sind ein wertvolles Fruchtfolgeglied im landwirtschaftlichen Anbau, denn sie können zur Bodenverbesserung beitragen, das Nährstoffmanagement optimieren, die Fruchtfolgen erweitern, Krankheiten unterdrücken und gelten als klima- und umweltfreundlich.

LG EAGLE
LG EAGLE ist eine mittelfrühe Ackerbohne mit hohem Ertrag bei überdurchschnittlicher Gesundheit.
Hinweise und Informationen
zum Anbau von Ackerbohnen
Standortansprüche von Ackerbohnen
- Ackerbohnen haben verhältnismäßig hohe Ansprüche an den Boden.
- Eine ausgeglichene Wasserversorgung über die gesamte Vegetationsperiode sollte gegeben sein. Besonders zum Zeitpunkt der Blüte und des Hülsenansatzes ist eine kontinuierliche Wasserversorgung wichtig.
- Tiefgründige, lehmige bis tonige, humusreiche Böden – Ackerzahl über 40 und pH-Wert 6,5 bis 7,5 – mit hohem Wassernachlieferungsvermögen sind am besten geeignet.
- Auf zeitiges Befahren im Frühjahr und damit die Möglichkeit früher Saat ist bei der Standortwahl besonderes Augenmerk zu legen.
Wissenswertes zur Fruchtfolge
- Auflockerung getreide- und maisintensiver Fruchtfolgen
- Mit sich selbst und anderen Schmetterlingsblütlern (Klee!) unverträglich. Anbaupausen von 4 bis 5 Jahren einhalten!
- Geringere Ansprüche an die Vorfrucht.
- Geeignete Vorfrüchte sind Getreidearten, Ausnahme Roggen und Hafer (Wirtspflanzen für Nematoden, die auch die Ackerbohne befallen).
- Die effektive Verwertung des von der Ackerbohne hinterlassenen Stickstoffs erfordert das Unterlassen unnötiger Bodenbearbeitung nach der Ernte und die Minimierung vegetationsloser Zeit.
- Die richtige Wahl der Folgefrucht (Wintergerste, Winterweizen), Zwischenfrüchte sowie ggfs. Frühsaaten reduzieren die Mineralisierung des fixierten Stickstoffs und somit die Gefahr der Nitratauswaschung in den Wintermonaten.
- Vorfruchteffekte sind neben der N-Lieferung die Bodengare, eine verbesserte Bodenstruktur, Humuslieferung und phytosanitäre Effekte.
Bodenbearbeitung - gut durchwurzelbar, feinkrümelig
- Eine gut durchwurzelbare Krume ist Voraussetzung für den erfolgreichen Ackerbohnenanbau.
- Eine gründliche und mindestens 15 cm tiefe Bodenlockerung hat im Herbst zu erfolgen. Eine Pflugfurche ist nicht zwingend erforderlich.
- Krumentiefe Lockerung ist nur notwendig, wenn Bodenverdichtungen vorliegen.
- Stoppelbearbeitung nach der Ernte der Vorfrucht zur Bekämpfung von Ausfallkulturen und Unkräutern lohnend, um u. a. den Bodenwasservorrat zu schonen.
- Die Saatbettbereitung sollte bei Befahrbarkeit der Böden zeitig, möglichst in der zweiten Februarhälfte, erfolgen. Vermeiden von Strukturschäden hat aber Priorität! („Spuren im Acker = Spuren im Geldbeutel“)
- Das Saatbett muss auf Ablagetiefe gelockert werden und ausreichend feinkrümelig sein.
Aussaat möglichst früh bei 5-8 cm
- So früh wie möglich, Ende Februar bis Mitte März, um die Vegetation optimal auszuschöpfen und hohe Ackerbohnenerträge zu realisieren.
- Minimaltemperaturen für die Keimung: 2 bis 3 °C
- Ablagetiefe liegt zwischen 5-8 cm, um den hohen Keimwasserbedarf zu decken. Weitere Vorzüge der tiefen Ablage sind bessere Wurzelausbildung und höhere Standfestigkeit.
- Reihenabstand je nach Sätechnik zwischen 15 und 45 cm
- Saatstärke
bei Einzelkornsaat: 30 – 35 kf. Körner/m²
bei Drillsaat: 40 – 45 kf. Körner/m²
Einzelkornsägeräte haben sich in der Praxis bewährt. Die verbesserte Standraumverteilung bietet besseren Lichteinfall für einen guten Hülsenansatz und bessere Standfestigkeit.
Düngung - kein Stickstoff nötig
- Keine Stickstoffdüngung nötig. N-Fixierungsleistung deckt den Eigenbedarf.
- Grunddüngung mittelfristig nach Entzug ausrichten. Im Rahmen der Fruchtfolge sollte Leguminosen bei der Grunddüngung jedoch bevorzugt werden.
- Entzüge:
P2O5: 12 kg pro t Korn
K2O: 14 kg pro t Korn
MgO: 2 kg pro t Korn - Schwefelbedarf: ca. 20 kg/ha
- Organische Düngung nicht empfehlenswert.
- Bei Kalkbedarf ist zu Ackerbohnen zu kalken.
Pflanzenschutz - Unkrautbekämpfung steht im Fokus
- Herbizidanwendung (im VA oder NA) aufgrund langsamer Jugendentwicklung notwendig!
- Zusätzlich besteht Gefahr der Spätverunkrautung. (Folge: Ernteerschwernisse)
- Problemunkräuter: Weißer Gänsefuß, Melde-Arten, Kamille & Klettenlabkraut.
- Auswahl distelfreier Standorte wichtig! (Für die Distelbekämpfung gibt es in Ackerbohnen keine zugelassenen Herbizide.)
- Fungizidanwendung ist nur selten (bei extremen Befallsdruck) erforderlich.
- Insektizide müssen im Mittel weniger als einmal, eventuell zur Bekämpfung der Schwarzen Bohnenlaus, eingesetzt werden.
- Bekämpfungsschwelle Schwarze Bohnenlaus: 5 – 10 % befallene Pflanzen. (Ziel: Blattlausfreiheit vor dem Aufblühen der Ackerbohnen)
- Zur Bekämpfung stehen Lambda-Cyhalothrin- und Pirimicarb-haltige Insektizide zur Verfügung.
Krankheiten und Schädlinge
- Schokoladenfleckenkrankheit (Botrytis fabae)
- Brennfleckenkrankheit (Asxochyta fabae)
- Bohnenrost (Uromyces phaseoli)
- Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae)
- Blattrandkäfer (Sitona lineatus)
- Ackerbohnenkäfer (Bruchus rufimanus)
- Stängelälchen-Nematoden
Ernte - max 24% Kornfeuchte!
- Ernte Ende August/Anfang September erfolgt im Drusch mit Standardmähdrescher.
- Zum Erntezeitprunkt müssen die Hülsen schwarz und die Körner hart sein, einzelne unreife Hülsen an den Triebspitzen können toleriert werden. Stängel sollte überwiegend braun bis schwarz verfärbt sein.
- Optimale Kornfeuchte für den Drusch: 15 – 17 % (max. 24 %)
- Quetschungen (Kornfeuchte > 24 %) und Bruch (Kornfeuchte < 15 %) der Körner sind beim Drusch zu vermeiden.
- Drusch sehr reifer Bestände zur Minimierung von Bruchkorn in die Morgen- oder Abendstunden verlegen
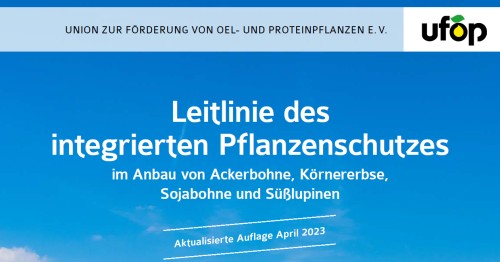
Die Leitlinie des integrierten Pflanzenschutzes im Anbau von Körnerleguminosen wurde herausgegeben von der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen e.V. (ufop), sie fasst den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema zusammen (zu Aspekten wie Standortwahl, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Aussaat, Förderung natürlicher Gegenspieler, regelmäßige Kontrollen im Bestand, Prognosemodelle und Informationsquellen).
Weitere Leguminosen von LG
Neben der Ackerbohne gibt es bei LG auch Körnererbsen.
